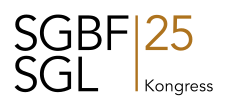Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Sitzung | ||
SESSION 10: Selbsteregulation und Kompetenzentwicklung
| ||
| Präsentationen | ||
Erfahrungen, die verbinden: Wie das selbstregulierte Lernen der Lehrpersonen mit der Förderung des selbstregulierten Lernens im Unterricht zusammenhängt. University of Zurich, Schweiz Selbstreguliertes Lernen (SRL) ist ein aktiver Prozess, der kognitive, metakognitive, motivationale, emotionale und verhaltensbezogene Fähigkeiten erfordert, um Wissen und Fähigkeiten zu erwerben (Zimmerman, 2002). Diese SRL-Kompetenzen sind für den schulischen und ausserschulischen Lernerfolg bedeutsam und bedürfen der Vermittlung und Förderung im Unterricht (Kirschner & Stoyanov, 2020). Die professionellen Kompetenzen der Lehrpersonen im Bereich des SRL sind für die erfolgreiche Förderung im Unterricht relevant (Kramarski & Heaysman, 2021). Diese professionellen Kompetenzen umfassen das Wissen, die Überzeugungen und die Motivation der Lehrperson sowohl als Vermittler:innen von SRL als auch als selbstregulierte Lernende (Karlen et al., 2020). Erste Untersuchungen zeigen, dass das eigene SRL von Lehrpersonen die Förderung des SRL bei Schüler:innen beeinflusst (Karlen et al., 2024). Mit ihrem erhöhtem Wissen und ihren positiven Erfahrungen als selbstregulierte Lernende, können die Lehrpersonen das SRL effektiver fördern (Askell-Williams et al., 2012). Sie erkennen die Schwierigkeiten ihrer Schüler:innen, passen ihre Förderung entsprechend an und vermitteln Lernstrategien, die sie selbst nutzen (Glogger-Frey et al., 2018). Es bleibt jedoch offen, inwiefern die Lehrpersonen ihren eigenen SRL-Kompetenzen eine Bedeutung beimessen und wie sich diese Wahrnehmung auf das Förderverhalten auswirkt. Die vorliegende Studie untersucht drei Forschungsfragen (FF):
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Mixed-Methods-Studie im Rahmen einer längsschnittlichen Interventionsstudie zur Förderung der professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen im Bereich SRL durchgeführt. N = 54 Lehrpersonen (61,1 % weiblich, MAlter = 34,56, SDAlter = 8,95) nahmen an der einjährigen Interventionsstudie teil. Die quantitativen Daten (einschliesslich Skalen zum eigenen SRL der Lehrpersonen, Überzeugungen über SRL und der SRL-Förderung) wurden mittels Onlinefragebogen vor und nach der Intervention erhoben. In einer Folgemessung wurden N = 19 Lehrpersonen (63,2 % weiblich, MAlter = 34,5, SDAlter = 9,14) aus der Experimentalgruppe sieben bis neun Monate nach der Intervention interviewt. Die thematische qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022) mit MAXQDA zielte auf tiefere Einblicke in die quantitativen Ergebnisse zum SRL der Lehrpersonen ab. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass sich alle Lehrpersonen als selbstregulierte Lernende wahrnehmen. Sie reflektieren ihre eigenen SRL-Kompetenzen und nennen Beispiele aus ihrem beruflichen Alltag, konzentrieren sich dabei jedoch hauptsächlich auf Planungsstrategien wie Zeitmanagement oder To-Do-Listen. Die Lehrpersonen betrachten ihre Erfahrungen als selbstregulierte Lernende als relevant für die Förderung des SRL ihrer Lernenden, insbesondere bei der Vermittlung von Lernstrategien und/oder in der Unterstützung der Lernenden. Allerdings gelingt es den Lehrpersonen nicht zu erklären, wie ihre eigene SRL-Erfahrung die Förderung von SRL beeinflusst. Zur Beantwortung dieser Frage fokussieren die Lehrpersonen auf ihre Rolle als Vermittler:innen, und greifen auf ihre Unterrichtserfahrung, bewährte Unterrichtsmethoden sowie Erfahrungen mit ehemaligen Schüler:innen zurück anstatt auf ihr eigenes SRL einzugehen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung des eigenen SRL die Förderung nicht beeinflusst. Die Lehrpersonen priorisieren in der Förderung von SRL ihre Rolle als SRL-Vermittler:innen höher als ihr eigenes SRL. Dies zeigt sich auch im geringen Interesse das eigene SRL weiterzuentwickeln. Stattdessen betonen sie das Bedürfnis mehr Wissen über die SRL-Förderung zu erlangen, um SRL im Unterricht erfolgreich zu fördern. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass Weiterbildungen den Lehrpersonen aufzeigen, wie ihr eigenes SRL die Förderung des SRL im Unterricht unterstützen kann. In einer weiteren Analyse werden die qualitativen Daten quantifiziert werden, um weitere Einblicke in das eigene SRL der Lehrpersonen, sowie den Zusammenhang des eigenen SRL mit der Motivation und SRL-Förderung zu gewinnen. Die Erkenntnisse dieser Analyse werden in den Beitrag einfliessen. Weiterbildung braucht Transferbegleitung im Berufsalltag – durch Coaching den Selbstregulationsprozess im Umgang mit Herausforderungen stärken Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz Die Bedingungen und Merkmale des Berufseinstiegs und -verlaufs von Lehrkräften sind von großer gesellschaftlicher Relevanz, insbesondere in Phasen des Lehrkräftemangels und aufgrund der komplexen Anforderungen im Klassenzimmer (Skaalvik & Skaalvik, 2018). Beim Berufseinstieg werden Lehrpersonen mit Entwicklungsaufgaben konfrontiert, auf die eine systematische Vorbereitung im Studium schwierig ist (Keller-Schneider, 2009) und für deren Bewältigung ihnen die Routine fehlt. In vielen Ländern wird über die hohe Stressbelastung berufseinsteigender Lehrpersonen berichtet (García-Carmona et al., 2019). Im Vergleich mit anderen Berufsgruppen ist auffällig, dass diese bis in die mittleren Berufsjahre auf vergleichsweise hohem Niveau anhält (Bleck, Weber & Lipowsky, 2019). Als zentrale Ressource im Umgang mit beruflichen Anforderungen gilt die Selbstregulation, eine handlungsorientierte, trainierbare Verhaltensdimension und ein wichtiger Aspekt der Professionalisierung von Lehrkräften (Kunter et al., 2013), denn sie wirkt emotionaler Erschöpfung entgegen und hat positive Effekte auf die Unterrichtsqualität und das berufliche Engagement (Klusmann et al., 2008). Selbstregulation wird als Fähigkeit charakterisiert, die eigene Kognition, Motivation, Emotion und das Verhalten bei der Verfolgung von Zielen zu kontrollieren (Zimmerman, 2002). Dazu gehört auch, sich Ziele zu setzen und über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten und Ziele angepasst werden müssen (Oettingen & Gollwitzer, 2001). Entsprechend wurden Trainingsprogramme zur Förderung der Selbstregulation entwickelt (Abujatum et al., 2007; Celebi et al., 2014; Li & Schwinger, 2024), um das Wohlbefinden von Lehrpersonen zu stärken. Individualisierte Beratungsangebote können den Transfer der Trainings in den Arbeitsalltag (Kanfer et al., 2006; Schaefer, 2012) unterstützen. Unser Beitrag beleuchtet die Frage, was es (1) im Selbstregulationsprozess an den Übergängen zwischen den Handlungsphasen braucht, damit eine zielgerichtete Bewältigung individuell bedeutsamer beruflicher Herausforderungen gelingt, und inwiefern es hilfreich ist (2) nicht nur die präaktionale Phase, sondern auch die Umsetzung entsprechender Handlungspläne im Berufsalltag durch Coaching zu unterstützen. Er ist Teil einer Interventionsstudie in der Weiterbildung von Lehrpersonen, die auf dem zyklischen Modell der Selbstregulation (Zimmerman, 2002; Schmitz et al., 2007) basiert und für die ein modulares Selbstmanagement-Training (SMT) und ein Online-Coaching (OC) zur Unterstützung des Praxistransfers konzipiert wurde (Bührer et al., 2024). Die Module des SMT (Bieri Buschor et al., 2018) ermöglichen, dass Lehrpersonen mittels AVEM (Schaarschmidt & Fischer, 2008) ihr Arbeitsverhalten analysieren, Methoden/Techniken zur Verbesserung der Selbstregulierung anwenden und diese anschliessend anhand eines Handlungsplans (Oettingen & Gollwitzer, 2001) zur Bewältigung individueller Herausforderungen im Berufsalltag umsetzen. Das Coaching wechselt nach dem SMT von einem instruktiven zu einem eher ko-kreativen Setting, das sich beim Transfer auf die Ziele und Bedürfnisse der Lehrkräfte konzentriert. Methodisch stützen wir uns auf eine differenzierte theoretische Analyse der Bedingungen erfolgreicher Selbstregulation sowie auf quantitative Analysen zweier Teilstichproben mit Daten zur Zielorientierung fünf sowie zehn Monate nach dem SMT: 65 Lehrkräfte haben am Training und Online-Coaching, 49 Lehrkräfte nur am SMT teilgenommen. Wir präsentieren Erkenntnisse dazu, wie das zyklische Rahmenmodell der Selbstregulation erweitert werden kann, so dass es …
Die deskriptiven Analysen zeigen, dass Lehrkräfte, die in der (prä-)aktionalen Phase mit Online-Coaching in der Umsetzung ihres Handlungsplans begleitet werden, ihre Handlungsziele häufiger über einen mehrmonatigen Zeitraum verfolgen als jene, deren Praxistransfer nicht begleitet wird. Unsere Ergebnisse leisten zudem einen praktischen Beitrag zur Ausgestaltung individualisierter Begleitmassnahmen bei Trainings zur Stärkung der Selbstregulierung von Lehrpersonen, und stützen die Bedeutung professionellen Coachings als Bestandteil solcher Massnahmen. Schließlich verweisen sie auf das Desiderat, den Ressourcenaufbau in der Weiterbildung zielgerichtet anzugehen sowie bereits in der Lehrpersonenausbildung die professionelle Entwicklung mittels der Wahl und Umsetzung individueller Ziele in Kombination mit Coaching voranzutreiben. Selbstreguliertes Lernen im Fokus: Multiperspektivische Analyse fachspezifischer Unterrichtspraktiken 1Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; 2Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft, Schweiz Theoretischer Hintergrund & Forschungsfragen Der Erwerb von Kompetenzen im selbstregulierten Lernen (SRL) ist ein wichtiges Bildungsziel und unterstützt Schüler*innen darin, zu lebenslangen Lernenden zu werden. SRL-Kompetenzen können besonders effektiv gefördert werden, wenn sie in Kombination mit fachspezifischen Aufgaben von Lehrpersonen vermittelt werden (Dignath & Veenman, 2021). Die fächerübergreifende Integration der SRL-Förderung in den Fachunterricht ist wichtig, da Schüler*innen beim Transfer ihrer SRL-Kompetenzen zwischen den Fächern oft Mühe haben (Schuster et al., 2020). Bisherige Studien zur SRL-Förderung durch Lehrpersonen konzentrierten sich meistens auf ein Fach oder unterschieden nicht zwischen Lehrpersonen verschiedener Fächer (Spruce & Bol, 2015). Inwiefern fachspezifische Unterschiede in den Unterrichtspraktiken von Lehrpersonen zur SRL-Förderung vorhanden sind, ist weitgehendst ungeklärt. Um ein differenziertes Bild der Unterrichtspraktiken von Lehrpersonen hinsichtlich ihrer SRL-Förderung zu gewinnen, ist es wichtig die Perspektiven von Lehrpersonen, Schüler*innen und die Beobachtungen der Forschenden zu erfassen. Zumal in der SRL-Forschung bisher wenig darüber bekannt ist, inwiefern diese drei Perspektiven miteinander übereinstimmen (Jud et al., 2024). Die vorliegende Untersuchung vergleicht daher die SRL-Förderung zwischen Lehrpersonen unterschiedlicher Fächer (Deutsch, Natur und Technik) mit einem multiperspektivischen Ansatz anhand folgender Forschungsfragen (FF):
Design & Methode Als Teil einer Längsschnittstudie analysiert diese Untersuchung ein Subsample von n = 28 Lehrpersonen der Sekundarstufe I, welches Lehrpersonen des Fachs Deutsch (n = 17; 76.5% weiblich; Alter M = 33.5, SD = 9.1) sowie Natur und Technik (n = 11; 54.4% weiblich; Alter M = 35.5, SD = 7.7) und ihre n = 515 Schüler*innen (Deutsch: n = 294; 42.4% weiblich; Alter M = 14.3, SD = 0.7; Natur und Technik: n = 221; 43.9% weiblich; Alter M = 13.7, SD = 0.7) inkludiert. Jede Lehrperson wurde zweimal videografiert. Die Auswertung erfolgte mithilfe des ATES Ratingmanuals (Dignath et al., 2022). Die Lehrpersonen und Schüler*innen beantworteten zudem im Herbst (t1) und im Sommer (t2) einen online-Fragebogen, der eine Skala zur selbstberichteten resp. wahrgenommenen SRL-Förderung enthielt (αLPt1 = .75, αLPt2 = .73; αSuSt1 = .82, αSuSt2 = .85) – vier Items zur direkten und vier Items zur indirekten Förderung. Resultate & Bedeutung FF1: Zu beiden Messzeitpunkten fokussierten die Lehrpersonen beider Fächer die Förderung metakognitiver Strategien und am wenigsten Strategien der Emotionsregulation. FF2: Nur bei der selbstberichteten indirekten SRL-Förderung gab es bei t2 einen signifikanten Unterschied zwischen den Lehrpersonen beider Fächer (Deutsch Mdn = 17.06, Natur und Technik Mdn = 10.55, U = 50.0, z = -2.087, p = .04). FF3: Signifikante Korrelationen zwischen den drei Perspektiven bestanden zwischen den Beobachtungen der Forschenden und den Selbstberichten der Lehrpersonen für Deutsch (t2: r = -.499, p < .05) und zwischen den Beobachtungen der Forschenden und den Berichten der Schüler*innen in Natur und Technik (t1: r = .673, p < .05). Die Resultate zeigen insgesamt ein geringes Ausmass an SRL-Förderung in beiden Fächern und kaum Unterschiede in der Förderung zwischen den Lehrpersonen der beiden Fächer. Das geringe Ausmass an SRL-Förderung könnte zu unentdeckten Unterschieden zwischen den Lehrpersonen der beiden Fächer beitragen. Die fehlenden signifikanten Korrelationen zwischen den Lehrpersonen- und Schüler*innen-Perspektiven deuten darauf hin, dass sie die SRL-Förderung unterschiedlich wahrnehmen. Die beiden signifikanten Korrelationen zwischen der Lehrpersonen- resp. Schüler*innen-Perspektive mit den Beobachtungen der Forschenden weisen darauf hin, dass die Wahrnehmung der Schüler*innen mehr in Übereinstimmung mit den Beobachtungen der Forschenden steht (positive Korrelation) als die selbstberichtete SRL-Förderung der Lehrpersonen mit den Beobachtungen (negative Korrelation). Es könnte sein, dass die Lehrpersonen dazu tendieren ihre SRL-Förderung zu überschätzen. | ||