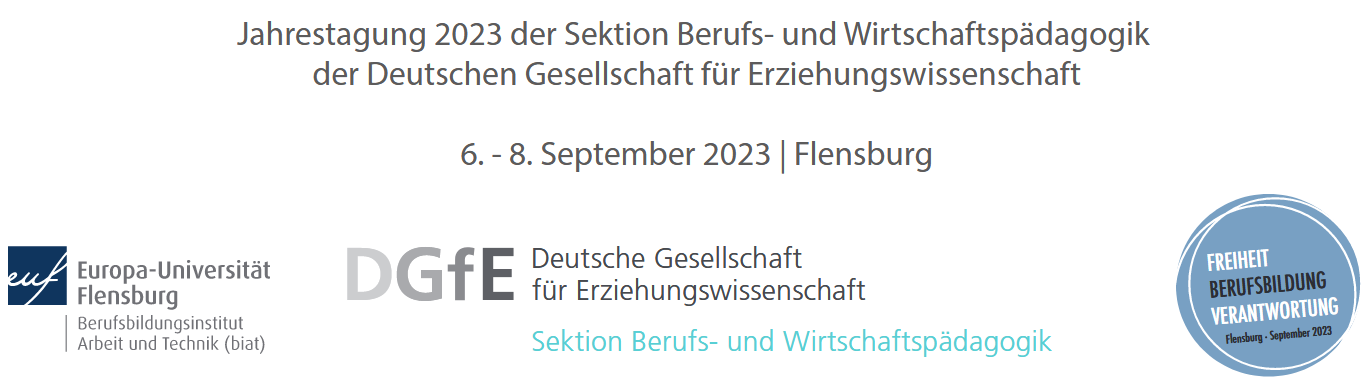Veranstaltungsprogramm der Jahrestagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2023
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
|
|
Sitzungsübersicht | |
|
Ort: Gebäude Tallinn (TAL) Raum 007 Kapazität: 40 Personen |
| Datum: Donnerstag, 07.09.2023 | |
| 10:45 - 12:15 | Session 1.8 Ort: Gebäude Tallinn (TAL) Raum 007 Moderation der Sitzung: Torben Karges |
|
|
Differenzielle Entwicklungen berufsfachlicher Kompetenzen in der Ausbildung von Kfz-Mechatroniker:innen: Welchen Einfluss hat der Schulabschluss? 1Technische Universität Dresden; 2Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), Kiel Arbeitskräfte benötigen berufsfachliche Kompetenzen, um ihre Tätigkeiten qualifiziert auszuüben. Der Erwerb dieser Kompetenzen ist das Ziel der Berufsausbildung. Wie sie sich im Ausbildungsverlauf entwickeln, welche interindividuellen Unterschiede bestehen und welche Bedeutung dem Schulabschluss – eine zentrale Ungleichheitsdimension am Übergang zur Ausbildung – zukommt, wurde bisher wenig erforscht. Wir untersuchen die Entwicklung berufsfachlicher Kompetenzen angehender Kfz-Mechatroniker:innen auf Basis der ManKobE-Studie. In Latent Change Modellen untersuchen wir interindividuelle Unterschiede in der intraindividuellen Entwicklung des Fachwissens (n=433) und der Diagnosefähigkeit (n=179) im 2. und 3. Ausbildungsjahr (AJ). Dabei berücksichtigen wir das Schulabschlussniveau der Azubis. Wir finden einen signifikanten Zuwachs im Fachwissen (FW; ∆MW= .41, p≤ .001). Dieser zeigt sich umso ausgeprägter, je höher das Vorwissensniveau der Azubis am Ende des 2. AJ ist (βT2= .33, p≤ .001). Für die Diagnosefähigkeit (DF) können wir dagegen keine Entwicklung feststellen (∆MW= .03, p> .05), wobei ebenfalls Unterschiede nach Ausgangsniveau bestehen – in entgegengesetzter Tendenz: Je höher das Niveau am Ende des 2. AJ, desto geringerer die Zuwächse (βT2= -.67, p≤ .001). Unter Berücksichtigung des Schulabschlussniveaus finden wir, dass Azubis mit MSA und (Fach-)HZB in beiden Kompetenzdimensionen am Ende des 2. AJ ein höheres Niveau aufweisen als jene mit max. Hauptschulabschluss (FW: βMSA, T2= .65; βHZB, T2= 1.03; jeweils p≤ .001; DF: βMSA, T2= .74, p< .01; βHZB, T2= 1.25, p≤ .001). Unter Kontrolle dessen finden wir keinen eigenständigen Effekt des Schulabschlusses auf die individuelle Kompetenzentwicklung (FW: βMSA, ∆= -.19, βHZB, ∆= -.18; DF: βMSA, ∆= .74, βHZB, ∆= .27; jeweils p> .05) Die Befunde weisen auf differenzielle Entwicklungstendenzen in der Ausbildung von Kfz-Mechatroniker:innen hin: Progression im Fachwissen, Stagnation in der Diagnosefähigkeit. Außerdem unterscheiden sich Azubis in ihrer Entwicklung: Das individuelle Kompetenzniveau am Ende des 2. AJ ist prädiktiv für die weitere Entwicklung. Schulabschlüsse bilden mittlere Kompetenzunterschiede ab, erklären die individuelle Kompetenzentwicklung aber nur bedingt: Bei gleichem Ausgangsniveau entwickeln sich Fachwissen und Diagnosefähigkeit ähnlich. Schulabschlussbezogene Rekrutierungsentscheidungen an der ersten Schwelle können damit individuelle Potenziale verdecken und Bildungsungleichheiten verstärken. Vermittlung einer Diagnosestrategie für Kfz-Störungen mittels videobasierter Modellierungsbeispiele und vergleichender Aufforderungen zur Selbsterklärung 1TU Dresden, Deutschland; 2Universität Erfurt, Deutschland Obwohl die Störungsdiagnose ein wichtiger Aspekt der Arbeit von Kfz-Mechatronikern ist, beherrschen nur etwa 15 % der Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung entsprechende Strategien. Da es sich bei der Kfz-Störungsdiagnose um Problemlösen handelt, bietet sich zur Strategievermittlung beispielbasiertes Lernen an. Um die Lernwirksamkeit von Beispielen (textbasierte Lösungsbsp. oder videobasierte Modellierungsbsp., MB) zu erhöhen, werden diese üblicherweise mit Aufforderungen zur Selbsterklärung kombiniert (SE-Prompts). Eine besondere Form der SE-Prompts fordert Lernende auf, mehrere Beispiele (bspw. unterschiedliche Lösungsansätze für ein Problem) zu vergleichen (vergleichende SE-Prompts, vSE-Prompts). Solche Vergleiche lassen sich für videobasierte MB schwierig umsetzen, da Lernende nicht zwei Videos gleichzeitig sehen können. Daher schlagen wir vor, videobasierte MB mit einer statischen Darstellung (bspw. einer tabellarischen Dokumentation des MB, Prüfplan) zu kombinieren. VSE-Prompts zielen anschließend auf diesen Prüfplan ab. In der hier vorgestellten Interventionsstudie wurde daher 118 Auszubildenden der Kfz-Mechatronik mittels videobasierter MB die Strategie (1) Aufstellen begründeter Vermutungen, (2) Planen der zugehörigen Messungen und (3) Durchführung der Messungen & Bewertung der Messergebnisse zur Kfz-Störungsdiagnose vermittelt. Als MB wurden Videos genutzt, in denen ein Experte die Strategie in einer Kfz-Computersimulation anwandte und dabei einen Prüfplan ausfüllte. Das Wissen und die Fähigkeiten der Auszubildenden bezüglich ihrer diagnostischen Strategien wurden im Prä-Post-Design erfasst. Die einmalig durchgeführte Intervention (Dauer: 105 Minuten) fand zwischen der Prä- und Post-Testung statt. Zur Erprobung der Interventionsinhalte wurden die Auszubildenden einer von drei Bedingungen zugeordnet: Sie lernten mit MB und (1) vSE-Prompts (d.h. Prüfplan des Experten und alternativer Prüfplan nebeneinander), oder (2) sequenziellen SE-Prompts (d.h. Prüfpläne nacheinander), oder (3) weder mit MB noch mit SE-Prompts. Die Ergebnisse zeigen einen positiven Effekt der MB auf das Diagnosewissen, nicht aber auf die Diagnosefähigkeiten. Den fehlenden Effekt auf die Diagnosefähigkeiten führen wir auf die kurze Interventionszeit und fehlenden Übungsmöglichkeiten zurück. Eine Kombination von videobasierten MB mit statischen Darstellungen erscheint nützlich, wobei die vSE-Prompts für stärkere Lernende mit mehr Vorwissen vielversprechend zu sein scheinen. Hochleistungspotentiale in Berufen des Handwerks erkennen und entwickeln – eine qualitative Analyse Bergische Universität Wuppertal, Deutschland Die aktuelle „Exzellenzinitiative Berufliche Bildung“ (BMBF, 2022) zeigt es deutlich: die Frage, wer sehr gute oder sogar herausragende berufliche Leistungen zu erbringen verspricht und wie potentielle Hochleistungsträger*innen gefördert werden können, ist für die Zukunft der beruflichen Bildung von hoher Bedeutung. Anders als für allgemeinbildende akademische Leistungen, ist diese Problemstellung für die berufliche Bildung jedoch lange vergleichsweise „stiefmütterlich“ behandelt worden (Stein, 2004). Aktuell werden multifaktorielle, beschreibende Modelle zur Entwicklung von Hochleistungspotentialen in Leistungsexzellenz wie das Münchner-Hochbegabungsprozessmodell (Ziegler & Perleth (1997) diskutiert. Allerdings leisten auch diese nur einen heuristischen Beitrag, denn empirische Prüfungen und Validierungen stehen bislang aus. Studien zeigen, dass kognitive Leistungstests allein nicht geeignet sind, um Auszubildende mit Hochleistungspotentialen zu identifizieren bzw. valide Leistungsprognosen zu ermöglichen (Niederhauser, 2017; Stamm, 2017). Hingegen erweisen sich beispielsweise Motivation und Volition als wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Leistungsexzellenz und zwar in Abhängigkeit vom Berufsfeld in deutlich unterschiedlichem Maße (Pylväs et al., 2017). Bis dato existiert jedoch weder ein Konsens darüber, auf Basis welcher Modellvorstellung oder welcher Operationalisierung Menschen, die in einer bestimmten beruflichen Domäne das Potential zur Leistungsexzellenz mitbringen, identifiziert werden können noch ob es prognostisch valide Vorhersagemöglichkeiten gibt, die berufsübergreifend generalisierbar sind. Angelehnt an die Systematik des Modells von Ziegler & Perleth (1997) wird in der vorgestellten Studie untersucht, welche Indikatoren für die Entwicklung von Hochleistungspotentialen für die unterschiedlichen Berufsfelder im Handwerk generisch vs. domänspezifisch sind. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews mit Ausbilder*innen aus sieben Sektoren des Handwerks geführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018) ausgewertet. Erste Analysen weisen sowohl auf generische als auch domänspezifische Indikatoren hin. Im Vortrag werden die vorliegenden Ergebnisse sowie Implikationen im Hinblick auf die angestrebte Modellbildung diskutiert und ein Ausblick auf die Ziele und Fragestellungen der geplanten Folgestudie geboten. |
| 14:00 - 15:30 | Symposien/Foren 2.1 Ort: Gebäude Tallinn (TAL) Raum 007 Moderation der Sitzung: H.-Hugo Kremer |
|
|
Innovation in Praxis und Forschung: Begleitforschung in der Berufsbildung im Rahmen des Förderprogramms InnoVET Beiträge des Symposiums Begleitforschung in großen bildungspolitischen Programmen – Zusammenwirken von Forschung und Praxis aus der Betrachtung von Translationsprozessen im Innovationsprogramm InnoVET Deutungsmuster von institutionellen Akteuren der beruflichen Bildung zu Innovationen im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung – Einblicke in den Ideenwettbewerb InnoVET „Go with the flow?!“ – Einblicke in Forschungsansatz und erste Ergebnisse des Begleitforschungsprojekts ITiB |
| 16:00 - 17:30 | Symposien/Foren 3.3 Ort: Gebäude Tallinn (TAL) Raum 007 Moderation der Sitzung: Roland Happ Moderation der Sitzung: Stephan Abele |
|
|
Digitalisierungsbezogene Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften im berufsbildenden Bereich Beiträge des Symposiums Das Grundlagenwissen angehender Lehrkräfte zu Künstlicher Intelligenz - Inhaltliche Modellierung und empirische Befunde Einstellungen angehender Lehrpersonen zu ethischen Aspekten des Einsatzes künstlicher Intelligenz im Unterricht Technologiebezogenes-pädagogisches Wissen angehender Berufsschullehrer:innen: eine quasi-experimentelle Feldstudie |
| Datum: Freitag, 08.09.2023 | |
| 8:30 - 10:00 | Session 4.8 Ort: Gebäude Tallinn (TAL) Raum 007 Moderation der Sitzung: Wolfgang von Gahlen-Hoops |
|
|
Interprofessional Collaborative Competency Attainment Scale (ICCAS) – Adaption für den berufsübergreifenden Einsatz TU München, Deutschland Gesundheits- und Pflegeberufe, nicht nur im klinischen Setting, sondern auch in Pflegeheimen oder in der häuslichen Umgebung, werden zunehmend von digitaler Technologie beeinflusst (vgl. Brynjolfsson & McAfee 2014) – insbesondere im Smart Home. Auch Elektroniker*innen sind davon betroffen: Die Kund*innen sowie in ihrem Auftrag handelnde Fachkräfte wie z.B. Pflegekräfte und Hauswirtschafter*innen sind auf technologische Unterstützung und Beratung angewiesen, um verantwortungsvolle Entscheidungen zu Themen wie Datensicherheit und Datenschutz treffen zu können. Demnach ist es notwendig, berufsübergreifend zusammenzuarbeiten (vgl. Striković & Wittmann 2022; Jarosch, Becker & Hofmann o.A.), womit auch das Erfordernis einer entsprechenden Befähigung an Relevanz gewinnt. Denkbar wäre hier-für bpsw. eine im Projekt „Teach@TUM4.0“ entwickelte Rollenspiel-basierte Lehr-Lerneinheit in einem Smart Home-Simulationslabor. Um jedoch erfassen zu können, inwieweit durch solche Maßnahmen Auszubildende der unterschiedlichen Berufsgruppen dazu befähigt werden, berufsübergreifend zu kooperieren, bedarf es der Entwicklung entsprechender Messinstrumente. Hierfür wurde ein aus der berufsübergreifenden Kooperation im Gesundheitswesen stammendes Messinstrument, das ICCAS, modifiziert und mittels TRAPD-Methode (European Social Survey 2020) ins Deutsche übersetzt. Im Beitrag wird der Frage nach dessen Verständlichkeit nachgegangen; es werden Ergebnisse und Implikationen eines Pretests berichtet. Literaturverzeichnis Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress and prosperity in a time of brilliant technologies. New York, NY: W. W. Norton & Company.European Social Survey (2020). ESS Round 10 Translation Guidelines. London: ESS ERIC Headquarters. Jarosch, J., Becker, D. & Hofmann, J. (o.A.). Schlussbericht. Smart Home & Living – Mehrwert 4.0. https://ez-gaw.de/wp-content/uploads/2018/06/Mehrwert40_ab-schlussbericht.pdf [30.03.2023]. Striković, A. & Wittmann, E. (2022). Collaborating Across Occupational Boundaries: Towards a Theoretical Model. Vocations and Learning, 15(2), 183–208. https://doi.org/10.1007/s12186-022-09284-w Ausbildungsabbrüchen in den Gesundheitsberufen präventiv begegnen im „Peer-to-Peer-Transfer“-Projekt: Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von Peersupport Systemen zur Förderung der sozialen Integration und Resilienz der Auszubildenden 1Katholische Hochschule Mainz, Deutschland; 2Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Deutschland Fragestellung Stress, Konflikte am Arbeitsplatz und fehlende soziale Unterstützung stellen häufige Gründe für Ausbildungsabbrüche in der Pflege dar (Garcia-González & Peters, 2021). Hinzu kommt das Fehlen positiver Rollenvorbilder und die Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildung. Diesen herausfordernden Rahmenbedingungen möchte das vom BMBF geförderte EMPOWER Teilprojekt „Peer-to-Peer-Transfer“ durch die Stärkung positiver Peerkontakte und der Resilienz der Auszubildenden begegnen. Theoretische Verortung Peersupport Systeme können die Zusammenarbeit, Solidarität und Integration von Auszubildenden in der beruflichen Bildung fördern (Colvin, 2015; Struck, 2022). Für die Pflegeausbildung wird die Implementierung solcher Systeme als Maßnahme der Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen identifiziert und empfohlen (Garcia-González & Peters, 2021). Diese positiven Effekte von Peerkontakten wurden international auch für Physiotherapie Studierende berichtet sowie der Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und Resilienz aufgezeigt (Bíró et al., 2016; Cassidy et al., 2020; Thomas, 2012). Überdies wird die Förderung der Resilienz positiv mit der Bewältigung von Arbeitsbelastungen, dem Erhalt der Gesundheit und der Sicherung des Verbleibes von beruflich qualifizierten Fachkräften assoziiert (Aryuwat et al., 2022; Collard et al., 2020; Garcia-González & Peters, 2021). Methodischer Zugang Mit Pflege- und Physiotherapieschulen werden Peersupport Systeme entwickelt und über zwei Ausbildungsjahre realisiert und analysiert. Für die Theorie(weiter)entwicklung und das Lösen relevanter Praxisprobleme, wird das Design Based Research methodisch ergänzt (Aprea, 2013; Schmiedebach & Wegner, 2021). Evaluiert werden die Akzeptanz der Maßnahmen sowie die Auswirkungen für die Auszubildenden entlang standardisierter Fragebögen und qualitativer, teilstrukturierter Interviews. Primäre Outcomes stellen die soziale Integration sowie die Stärkung von Resilienz (Kaiser et al., 2019) und beruflicher Identität (Rauner, 2017) dar. Zudem werden die Ausbildungsqualität und die Abbruchsneigung (Krötz & Deutscher, 2021) erhoben. Ergebnisse Erste Ergebnisse werden im Sommer 2024 erwartet, aktuell sollen die inhaltliche Konzeption und das forschungsmethodische Design präsentiert werden. Relevante/mögliche Implikationen Die evaluierten Maßnahmen sollen für die Ausbildung in den Gesundheitsberufen nutzbar gemacht werden und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Fachkräftesicherung leisten. Wahlrecht gesonderter Berufsabschlüsse in der generalistischen Pflegeausbildung: Wieviel Wahlfreiheit haben Auszubildende? 1Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH; 2Hochschule Esslingen Mit dem Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes startete 2020 die generalistische Pflegeausbildung. Sie bündelt die drei ehemaligen Ausbildungen zur beruflichen Qualifizierung für die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer Ausbildung und mündet im Abschluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, nach den beiden ersten generalistisch ausgerichteten Ausbildungsjahren eine Spezialisierung zu wählen und durch eine entsprechend gewählte Vertiefung im letzten Ausbildungsdrittel einen gesonderten Abschluss zum/zur „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in“ oder „Altenpfleger/in“ zu erwerben. Im Vortrag werden Ergebnisse aus der Begleitforschung zur Einführung der generalistischen Pflegeausbildung vorgestellt. Es liegen 80 leitfadengestützte Interviews mit Akteuren aus Pflegeschulen und Betrieben vor, die inhaltsanalytisch (Mayring) analysiert wurden. Theoretisch können alle Auszubildenden das Wahlrecht in Anspruch nehmen. Praktisch ist die Ausübung des Wahlrechts durch die Auszubildenden jedoch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Viele Pflegeschulen und Praxiseinrichtungen bieten die gesonderten Abschlüsse jedoch nicht an. Die Gründe dafür liegen z. B. in einem Mangel an Lehrpersonal, welches über die Expertise für die jeweilige Spezialisierung verfügt, und organisatorischen Hürden bei der Umsetzung des gesonderten Unterrichts. Dies betrifft insbesondere die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Dort kommt der Mangel an pädiatrischen Einsatzplätzen in der Praxis erschwerend hinzu. Interessierte Auszubildende müssen die Einrichtungen, die gesonderte Abschlüsse anbieten, gezielt suchen. Die Entscheidung der Auszubildenden für oder gegen einen gesonderten Abschluss hängt z.B. auch mit der Entfernung zwischen Wohnort und Lernorten für den theoretischen und praktischen Teil der Ausbildung zusammen. Dazu kommen Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Konsequenzen der Entscheidung. Welche Einschränkungen, z.B. bei vorbehaltenen Aufgaben, sind mit den gesonderten Abschlüssen verbunden? Werden die gesonderten Abschlüsse zukünftig beibehalten oder sind es „Auslaufmodelle“? Ist der generalistische Abschluss die sicherste Variante? Diese Hürden führen zu der Frage, wie frei Auszubildende bei der Wahl eines gesonderten Abschlusses tatsächlich sind. Die Diskrepanz zwischen der rechtlich vorgesehenen und tatsächlichen Freiheit bei der Ausübung des Wahlrechts wird diskutiert. |
|
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: BWP 2023 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.150 © 2001–2024 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |